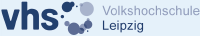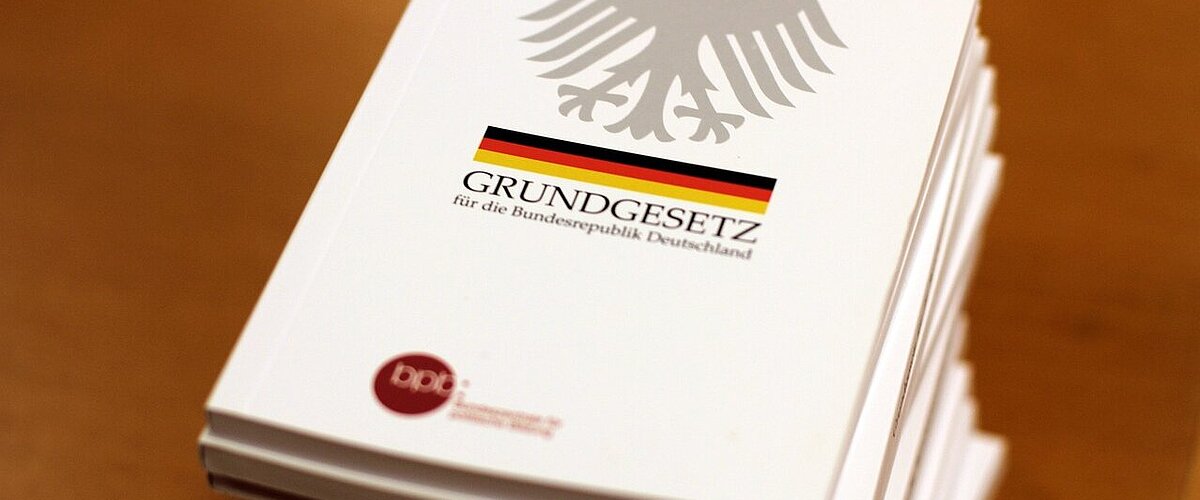
Die Schuldenbremse – Reform im Grundgesetz
Die Schuldenbremse ist eine Regelung im deutschen Grundgesetz, die sicherstellen soll, dass der Staat nicht übermäßig neue Schulden aufnimmt. Eingeführt wurde sie 2009. Die Schuldenbremse erlaubt dem Bund eine begrenzte Neuverschuldung von maximal 0,35 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP), um die Staatsverschuldung zu kontrollieren und die langfristige finanzielle Stabilität Deutschlands zu sichern. Bundesländer dürfen laut der Regelung grundsätzlich keine neuen Schulden machen.
Herausforderungen und Reformbedarf
In den letzten Jahren gab es einige außergewöhnlichen Situationen, für die erhebliche finanzielle Mittel nötig waren: wie zum Beispiel die Pandemie, die Ahrtal-Flutkatastrophe und geopolitische Spannungen wie der Ukrainekrieg. Mit den strikten Vorgaben der Schuldenbremse ist es schwierig flexibel auf solche Krisen zu reagieren. Daher wurde diskutiert, die bestehenden Regelungen im Grundgesetz anzupassen, um dem Staat mehr finanziellen Handlungsspielraum zu geben.
Geplante Änderungen im Grundgesetz
Um den finanziellen Anforderungen gerecht zu werden, gab es jetzt (März 2025) den Beschluss von Bundestag und Bundesrat die Artikel 109, 115 zu ändern und einen neuen Artikel 143h im Grundgesetz einzuführen. Durch diese Reform können sich Bund und Länder unter bestimmten Bedingungen eine höhere Neuverschuldung zu erlauben.
Artikel 109 GG: Anpassung der Kreditaufnahme
Artikel 109 regelt die Haushaltswirtschaft von Bund und Ländern. Die Änderung soll es den Ländern nun in besonderen Notlagen, wie z.B. Naturkatastrophen wie damals im Ahrtal, ermöglichen Kredite aufzunehmen und so flexibler auf Krisen zu reagieren. Zuvor konnte das nur der Bund.
Artikel 115 GG: Erweiterte Kreditaufnahme für den Bund
Artikel 115 bestimmt die Kreditaufnahme des Bundes. Mit der Reform kann der Bund höhere Schulden aufnehmen als bisher – also mehr als 0,35 % des BIP -, wenn außergewöhnliche Umstände dies erfordern.
Einführung von Artikel 143h GG: Schaffung von Sondervermögen
Der neu eingeführte Artikel 143h ermöglicht die Einrichtung von Sondervermögen für bestimmte Zwecke, wie Investitionen in Infrastruktur, Bildung oder Klimaschutz. Diese Sondervermögen – bis zu 500 Milliarden Euro - werden außerhalb des regulären Haushalts geführt.
Fazit und mehr
Bei der Umsetzung gibt es noch Kritik an der unklaren Definition von Sondervermögen und fehlenden Regeln für die Nutzung.
Hier finden Sie weitere Artikel zum Thema:
Bundeszentrale für Politische Bildung: Staatshaushalt und Schuldenbremse